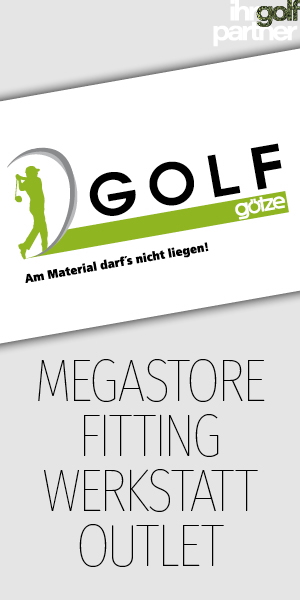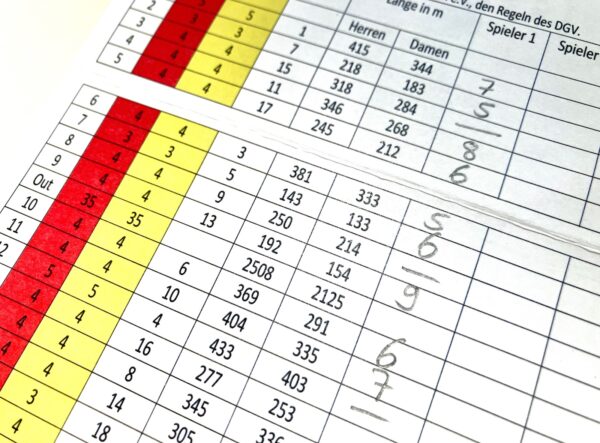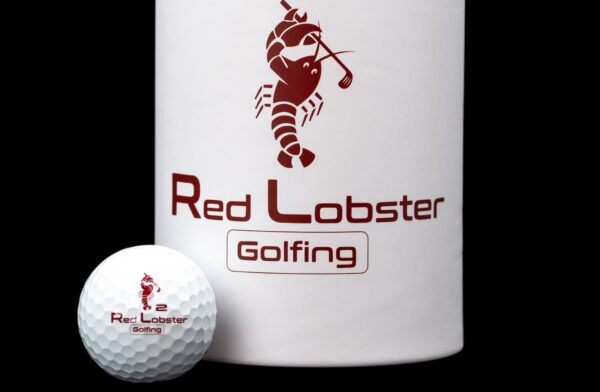Wer heute einen neuen Driver oder ein Eisen kauft, entscheidet sich meist für einen Schaft aus dem Standardangebot des Herstellers. Diese „Serienschäfte“ sind auf ein breites Spektrum von Spielern ausgelegt und sollen für möglichst viele Golfer funktionieren. Doch wer das Maximum aus seiner Ausrüstung herausholen will, kommt an einer Kategorie nicht vorbei: den Aftermarket-Schäften.
Verschiedene Biegeprofile
Das sind Premium-Golfschäfte, die – grob gesagt – unabhängig von den großen Schlägerherstellern entwickelt und verkauft werden. Sie werden nicht als Standardschäfte in Golfschlägern verbaut, sondern im Schläger-Fitting individuell ausgewählt und angepasst. Aftermarket-Schäfte sind gewissermaßen das technische Feintuning für Golfschläger. Ihr Ziel: die Performance des Spielers durch exakt abgestimmte Spezifikationen zu verbessern. Die Schäfte haben ein klar definiertes Biegeprofil: Tip, Mid oder Butt. So lässt sich das jeweilige Modell anhand von Faktoren wie Schwunggeschwindigkeit, Transition und Eintreffwinkel auswählen.
„Der Herstellungsprozess, die Qualität der Komponenten und die niedrigen Toleranzen haben natürlich ihren Preis“, betont Paul Windecker, Fittingexperte von Fachhändler Golf Götze in Weiterstadt. Gute Aftermarket-Schäfte seien ab rund 350 Euro pro Stück zu haben. Manche Modelle kosteten aber auch ein Mehrfaches.
Fujikura, Graphite Design und TPT sind die Bekanntesten
Die bekanntesten Hersteller sind Fujikura, Graphite Design und TPT. Sie fertigen ihre Schäfte aus besonders hochwertigen Karbonfasern und nutzen aufwendige, meist patentierte und gut gehütete Technologien (z.B. VeloCore), um Festigkeit und Präzision zu erreichen sowie verschiedene Biegeprofile. Laut Windecker spielt rund die Hälfte der aktuell zehn besten Golfer der Welt beispielsweise ein Modell des Ventus von Fujikura.
Der Vorteil von Aftermarket-Schäften: Sie können Leichtigkeit und Stabilität kombinieren – zwei Attribute, zwischen denen man sich lange entscheiden musste. Ihre Stabilität verdanken sie einer besonders hohen Dichte an Karbonfasern. Dadurch lässt sich der Schläger einerseits leichter und stärker beschleunigen. Andererseits ovalisiert der Schaft im Schwung weniger. Die höhere Torsionsstabilität reduziert ungewollte Verdrehungen des Schafts, was zu konstanteren Ballstarts führen kann.

„Der Vorteil der Aftermarket-Schäfte ist messbar, nicht nur am geringen Gewicht und am niedrigen Torque-Wert, sondern auch im Schlagresultat“, erklärt Fitting-Fachmann Windecker. Fünf bis zehn Meter Längengewinn mit dem Driver können durch einen gefitteten Aftermarket-Schaft – verglichen mit einem Standard-Modell – durchaus drin sein. Nicht weniger, aber in der Regel auch nicht deutlich mehr.
Zwischen sinnvollem Fein-Tuning und Statussymbol
Wer hohe sportliche Ziele verfolgt und das Optimum aus seinem Driver herausholen will, ist wohl eher bereit, den Mehrpreis für einen besonders hochwertigen Schaft zu zahlen. Wer Golf dagegen eher als entspannten Zeitvertreib betrachtet, könnte den Mehrpreis aber auch für einen übertriebenen Luxus halten. Laut Golf Götze in Weiterstadt entscheiden sich rund fünf Prozent der Kunden für einen Schaft à la carte. Wobei die meisten von ihnen bereits mit konkreten Vorstellungen zum Fitting kommen. Sinnvolles Fein-Tuning und der Wunsch nach einem Statussymbol im Golfbag verschwimmen mitunter.
„Ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, dass ein Aftermarket-Schaft nichts für durchschnittliche Amateurspieler ist“, betont allerdings Inhaber Jan Götze. „Wenn ein älterer Herr seinen Driver unbedingt wieder über 150 Meter weit hauen möchte, dann braucht er dafür jede Hilfe, die er kriegen kann.“ Hersteller, die sich mit ihren Schäften auf eine Zielgruppe mit niedrigerer Schlägerkopfgeschwindigkeit spezialisiert haben, sind Honma und XXIO. Und zwar nicht nur mit Hölzern, sondern auch mit Eisen. Das unterscheidet sie von Fujikura, Graphite Design und TPT, die ihr Spielfeld bisher eher bei den Hölzern sehen: Driver, Fairway-Hölzer und Hybrids.
TPT ist aktuell der „Hot Shit“ der Aftermarket-Schäfte
„Der Hot Shit unter den Herstellern ist aktuell eindeutig TPT“, berichtet Paul Windecker. Das Unternehmen mit Sitz in der französischen Schweiz, das auch Komponenten für den Segelsport, die Luftfahrt und den Motorsport produziert, reklamiere für sich zurecht eine Revolution in der Schaftherstellung. TPT habe ein Verfahren entwickelt, um dünne Karbonmatten – Ausgangsmaterial aller Karbonschäfte – konisch zu wickeln.
„Es gibt dadurch keine Stoßnähte und keinen Spine (Wirbelsäule, Anm. d. Red.) mehr, was bei einem richtungsempfindlichen Material wie Karbon vorher durchaus einen Einfluss auf die Performance hatte“, erklärt Diplom-Maschinenbau-Ingenieur Windecker. Das mache das sogenannte „Pureing“ überflüssig. Denn es sei egal, wie die Spitze eines TPT-Schafts (ab 380 Euro) in den Schlägerkopf eingebaut werde, weil er sich schlicht aus jeder Richtung gleich verhalte.
Das hat auch den US-Putterhersteller LAB Golf mit seinen „torqueless“ Puttern zu einer Zusammenarbeit mit TPT bewogen. Aber auch andere Golfmarken wie PING kooperieren mit den Herstellern von Aftermarket-Schäften, um sich „brand exclusive“ Schäfte für bestimmte Schlägerköpfe entwickeln und fertigen zu lassen.
Im Fall von TPT sind der Long-Drive-Spezialist Martin Borgmeier und der Österreicher Bernd Wiesberger hierzulande die wohl bekanntesten Nutzer. „Auf den Touren sind TPT-Schäfte bisher noch wenig zu sehen“, sagt Paul Windecker. Vermutlich sei das aber nur noch eine Frage der Zeit. TPT habe bereits angekündigt, bald auch Aftermarket-Schäfte für Eisen auf den Markt zu bringen.